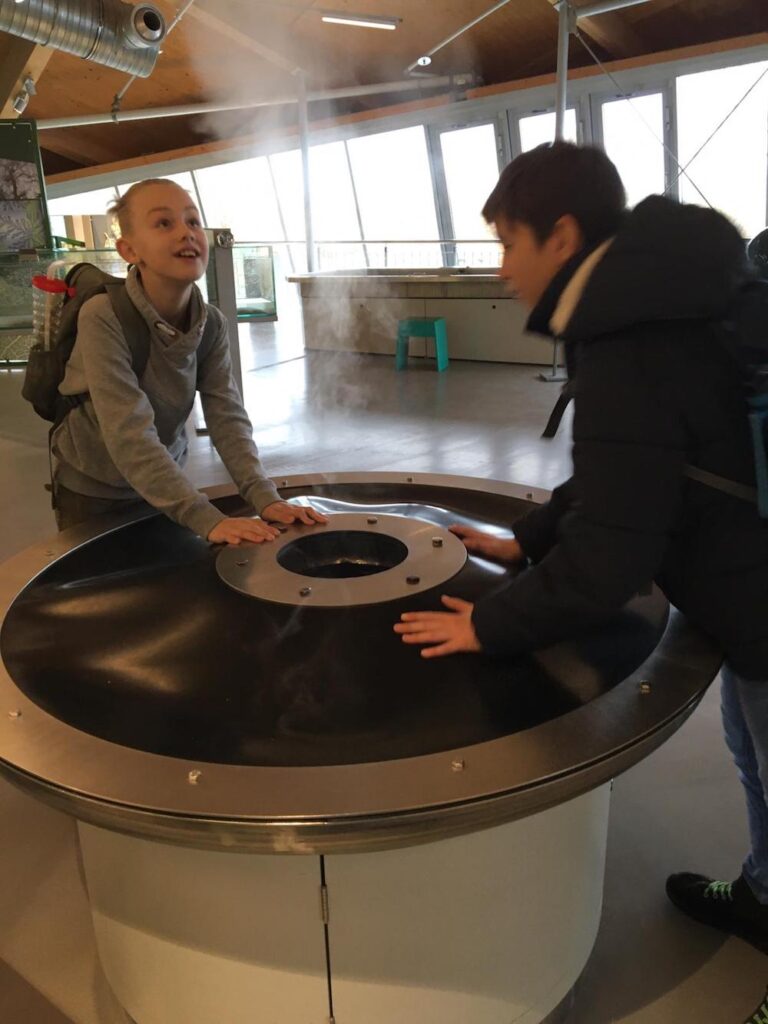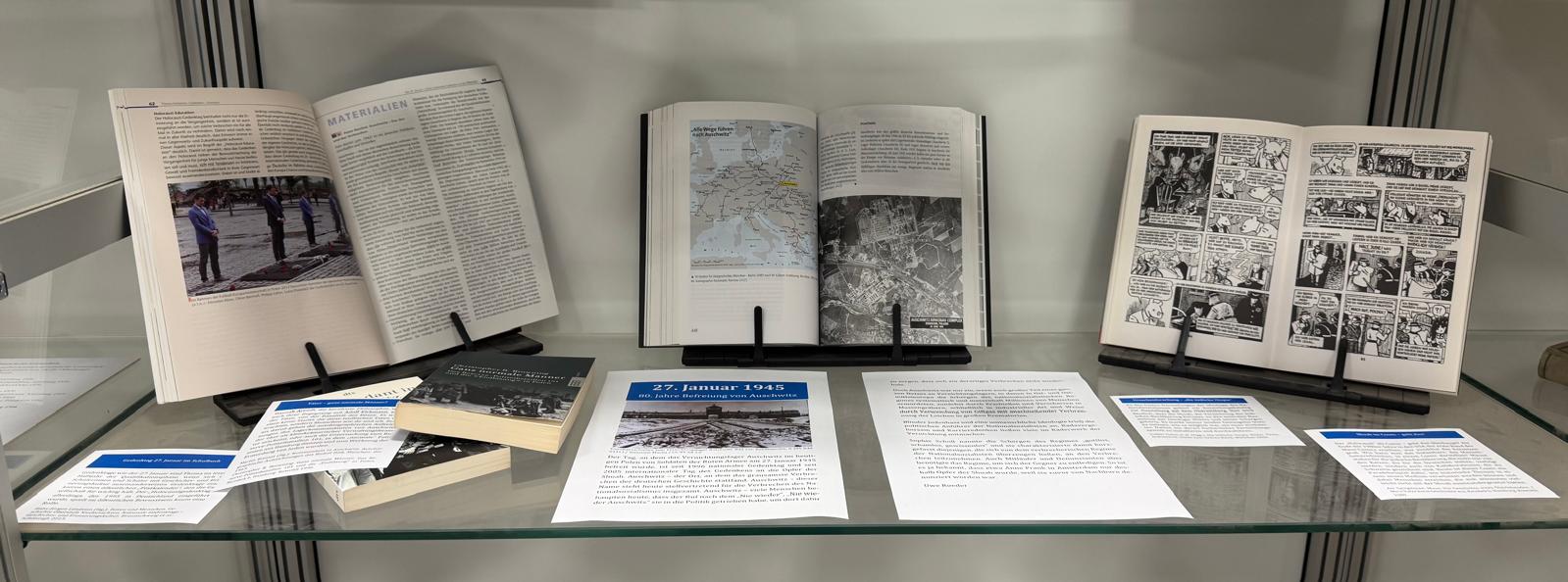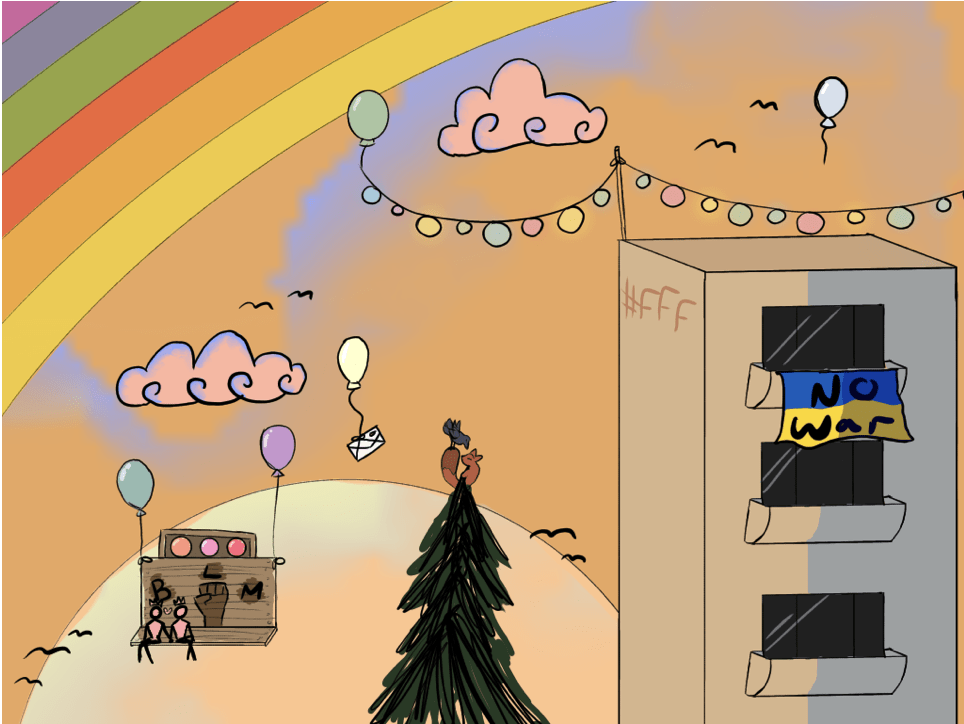Eröffnung des Jubiläumsjahres
Gestern eröffnete unser Schulleiter vor dem Vortrag von Prof. Dr. Michael Sommer über „Vox populi – die liberale Demokratie und ihre Feinde“ offiziell das Jubiläumsjahr 2023. Frank Marschhausen verwies dabei nach einem Dank an den Referenten und an den Organisator auf 450 Jahre Wandel, die die Geschichte des Alten Gymnasiums begleitet hätten, um schließlich die künstliche Intelligenz als Herausforderung der jungen Generation für die Zukunft zu unterstreichen, der man sich stellen müsse.
Prof. Sommer ist der Oldenburger Öffentlichkeit vor allem durch seine NWZ-Kolumne „Sommerzeit“ bekannt. Er eröffnete die Vortragsreihe zum Jubiläum vor vollem Hause – eine Situation, die wir seit Beginn der Coronamaßnahmen nicht mehr hatten. Viele Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, Ehemalige und Interessierte hörten einen Vortrag über Populismus als Mechanismus des Machterwerbs durch politische Eliten, nämlich über die politische Strategie, dem Volk nach dem Mund zu reden. Ziel dabei sei es, politische Macht in einem Gemeinwesen zu erringen oder zu befestigen. So operationalisierte Prof. Sommer mit Verweis auf Ralf Dahrendorf und Max Weber den Begriff „Populismus“, nachdem er unter anderem darauf hingewiesen hatte, dass er in der politischen Debatte heute als Kampfbegriff verwendet werde, um dem jeweiligen politischen Gegner genau diesen vorzuwerfen. Sodann spannte er den Bogen zurück in die Antike, um an Beispielen aus der athenischen Demokratie und der römischen Republik schlaglichtartig Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Vorgehensweise der politischen Eliten gegenüber dem δῆμος (demos) bzw. dem populus, also dem Volk als Träger der politischen Gewalt, zu exemplifizieren.
In Athen seien politische Ämter mit Ausnahme des militärischen Oberbefehl – hier wollte man einen Fachmann – grundsätzlich per Los vergeben worden. Das habe dazu geführt, dass der πολίτης (polites), der Bürger Athens, zugleich auch für die Stadtgemeinschaft habe tätig werden müssen. In diesem Konzept also waren alle Bürger in der Volksversammlung an der politischen Willensbildung beteiligt. Dabei hätten Demagogen, Anführer des Volkes, aufgrund ihrer rhetorischen Bildung und ihres Charismas die Entscheidungen dort wesentlich beeinflusst. Prof. Sommer nannte in diesem Zusammenhang den Einfluss, den Perikles als Demagoge dabei hatte, in einen desaströsen Krieg mit dem Rivalen Sparta einzutreten, den Athen nach dreißigjährigem Ringen schließlich verlor.
Ganz anders sei das Verhältnis von populus und politischer Elite, der Nobilität, in Rom gewesen. Dort habe sich die politische Elite faktisch dadurch vom Volk abgegrenzt, dass alle wesentlichen politischen Entscheidungen im Senat gefallen seien, einem Gremium. der die ehemaligen Magistrate der Stadt angehörten. Hier sei es sehr selten gewesen, dass ein Außenstehender als homo novus in den Kreis dieser Nobilität eingetreten sei. In den Volksversammlungen, die es in Rom auch gab, hätten weniger konkrete politische Fragen als vielmehr Patronatsbeziehungen und persönliche Abhängigkeiten eine Rolle gespielt. Erst als mit Tiberius Gracchus beginnend der Konsens der Nobilität, politische Entscheidungen im Senat und nicht in der Volksversammlung zu treffen, zerbrochen sei, habe sich eine populistische Politik herausgebildet, mit der deren Vertreter ihre Machtbasis hätten ausbauen wollen. An der Unfähigkeit der Nobilität, die Krisen zu bewältigen, die mit der Expansion Roms und der Eroberung der Mittelmeerwelt verbunden gewesen seien, sei die römische Republik am Ende gescheitert.
Schließlich kam Prof. Sommer mit einem Zwischenstopp bei den Verfassungsvätern der USA auf die Gegenwart zurück und mahnte Bildung als notwendige Voraussetzung an, um die Mechanismen zu erkennen, mit denen populistische Politik heute gemacht wird.
In einer anschließenden Plenumsdiskussion ging es im Wesentlichen um aktuelle politische Fragen. Herr Sommer verwies etwa auf die Notwendigkeit, innerhalb einer Gesellschaft für ein Mindestmaß an Solidarität zu sorgen, für die es gemeinsamer und verbindender Elemente bedürfe. Er meinte, er kenne hierfür keine anderen Konzepte als Religion und Nation, die in der Lage wären, dieses Maß an Solidarität innerhalb eines Volkes herzustellen, und warnte davor, etwa durch eine gendergerechte Sprache künstlich immer neue Barrieren aufzubauen, die das Volk spalteten, ein Volk, in dem Platz sein müsse für das friedliche Austragen unterschiedlicher Interessen und Standpunkte. Hatte Prof. Sommer zu Beginn seines Vortrages als Althistoriker und Altphilologe die humanistische Tradition des Alten Gymnasiums noch mit dem Wunsch verbunden, die Antike mit ihrer Kultur und ihren Sprachen dort wieder stärker zu betonen, so kam er am Ende noch einmal auf das Alte Gymnasium zurück und dankte den Kolleginnen und Kollegen ausdrücklich dafür, dass die Schule dazu beigetragen habe, seinem Sohn, der 2021 am Alten Gymnasium Oldenburg das Abitur gemacht hat, einen Bildungsbegriff zu vermitteln, mit dem dieser in der Lage sei, sich als Bürger kritisch in die Gesellschaft einzubringen.